
Mehr Geld für Sicherheit und Infrastruktur
Am 18. März 2025 trat der alte Bundestag aber noch einmal zusammen, um über einen Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes abzustimmen. Dieser sah vor, Ausgaben für Verteidigung und bestimmte sicherheitspolitische Ausgaben ab einer bestimmten Höhe künftig nicht mehr auf die Schuldenregel des Grundgesetzes anzurechnen.
Darüber hinaus sollte im Grundgesetz die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von 500 Milliarden Euro „für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045“ ermöglicht werden. Die in diesem Rahmen aufgenommenen Kredite sollten ebenfalls von der Schuldenregel ausgenommen werden. Das Ziel: dem Staat für die nächsten Jahre mehr finanziellen Handlungsspielraum zu verschaffen.
Ökonomen rechnen mit Wirtschaftswachstum
Das Sondervermögen und die kreditfinanzierten Verteidigungsausgaben werden der deutschen Wirtschaft einen deutlichen Schub verleihen – allerdings erst 2026. Das geht aus der aktuellen Frühjahrsprognose des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) hervor. Demnach zeigt der Ausblick für 2025 unverändert eine Stagnation (0,0 Prozent). Für das kommende Jahr revidiert das IfW Kiel seine Erwartungen gegenüber der Winterprognose merklich um 0,6 Prozentpunkte nach oben und rechnet jetzt mit einem Plus von 1,5 Prozent. Kehrseite ist ein steigender Schuldenstand auf über 65 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), auch für den Preisauftrieb gibt es noch keine Entwarnung.
Ähnlich urteilt auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): „Das geplante Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen könnte im kommenden Jahr für einen deutlich stärkeren Wirtschaftsaufschwung als prognostiziert sorgen“, so DIW-Konjunkturchefin Dr. Geraldine Dany-Knedlik. Für 2025 rechnet das DIW ebenfalls mit einer Stagnation, für 2026 mit einer deutlichen Erholung um 1,1 Prozent.
Arbeitsmarkt ist insgesamt noch stabil
Mit keinem Wachstum 2025 würde die deutsche Wirtschaft im dritten Jahr in Folge stagnieren. Derzeit ist Deutschland Schlusslicht unter den großen Euroländern. Das zeigt sich auch am Arbeitsmarkt. Dieser bleibt aber trotz herausfordernder wirtschaftlicher Lage und verhaltenen Frühjahrsbelebung stabil. Die Zahl der arbeitslosen Menschen lag im März 2025 bei 2.967.000. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,4 Prozent, ein Anstieg von knapp 7 Prozent gegenüber März 2024.
Deutsche Wirtschaft startet gut ins neue Jahr
Es gibt aber auch Lichtblicke: Das BIP ist im 1. Quartal 2025 gegenüber dem 4. Quartal 2024 um 0,2 Prozent gestiegen, nachdem es zum Jahresende 2024 noch zurückgegangen war. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren sowohl die privaten Konsumausgaben als auch die Investitionen höher als im Vorquartal. Im direkten Vergleich zum Vorjahresquartal gab es aber dennoch einen leichten Rückgang des BIP um 0,4 Prozent.
Rahmenbedingungen bleiben herausfordernd
Das geringe Wirtschaftswachstum hat mehrere Gründe. In der Gemeinschaftsdiagnose, die von führenden Wirtschaftsforschungsinstituten zweimal jährlich im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erstellt wird, werden einige genannt: verstärkter internationaler Wettbewerb, protektionistische Wirtschaftspolitik durch die USA, aber auch strukturelle Schwächen wie Fachkräftemangel.
Deshalb fordern die Wissenschaftler in ihrem Gutachten grundlegende Reformen: „Deutschland leidet nicht nur unter einer Konjunkturschwäche, sondern hat vor allem Strukturprobleme. Sie lassen sich nicht durch eine bloße Erhöhung der Staatsausgaben lösen und machen potenzialstärkende Reformen umso dringlicher.“
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW)
Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien hat 2024 einen neuen Rekordwert erreicht. Mehr als die Hälfte des Bruttostromverbrauchs in Deutschland konnte so umweltfreundlich gedeckt werden. Insbesondere die Stromerzeugung aus Offshore-Windkraft und Photovoltaik hat zu dieser positiven Entwicklung beigetragen – trotz eines eher unterdurchschnittlichen Sonnenjahrs. Der Ausbau der Photovoltaik ging dabei unvermindert weiter: 2024 wurden Anlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 17 Gigawatt installiert, im Vergleich zum Vorjahr wieder ein Rekordhoch.

Insgesamt betrug die Stromerzeugung 2024 in Deutschland knapp 489 Milliarden Kilowattstunden Strom – 2,4 Prozent weniger als im Jahr davor. Der Strombedarf lag darüber, bei etwa 512 Milliarden Kilowattstunden. In den kommenden Jahren soll er deutlich ansteigen: Prognosen der Bundesregierung zufolge könnten bis 2030 bis zu 750 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr erforderlich sein. Ein Grund dafür: In den Bereichen Gebäude, Verkehr und Industrie wird verstärkt auch auf Elektrifizierung gesetzt, um Emissionen zu reduzieren.
Umso wichtiger sei es deshalb, das Energiesystem unabhängiger zu machen, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung: „Angesichts der wachsenden geopolitischen Unsicherheiten muss es in den kommenden Jahren darum gehen, Resilienz und Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa zu stärken und Energie bezahlbar zu halten. Ein resilientes Energiesystem ist die Basis für Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.“ Dafür sei es essenziell, die erneuerbaren Energien, die Wasserstoff-Infrastrukturen sowie die Speicherkapazitäten auszubauen.
Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e. V. (textil+mode)
Die deutsche Textilindustrie ist eine Zulieferindustrie. Die anhaltende wirtschaftliche Stagnation in Deutschland trifft sie besonders. 2024 ist die deutsche Textil- und Modeindustrie daher geschrumpft. Beide Segmente, sowohl die Textil- als auch die Bekleidungsindustrie, waren in ähnlichem Ausmaß vom Konjunkturrückgang betroffen. Der Bereich Textil verlor nach dem schwachen Vorjahr 2023 nochmals 4,6 Prozent, im Bereich Bekleidung sanken die Umsätze nach einem kräftigen Plus im Vorjahr 2024 um 3,7 Prozent. Insbesondere der wichtige Bereich der technischen Textilien musste einen erheblichen Umsatzrückgang hinnehmen.

Auch der Außenhandel leistete, wie schon im Vorjahr, keinen positiven Beitrag. Im Gegenteil: Der Beitrag des Auslands zum Umsatzrückgang war sogar überproportional hoch. Dies war in den Vorjahren meist umgekehrt, die Auslandsumsätze trugen in der Regel überproportional positiv zum Gesamtumsatz bei. Besonders gesunken sind die Umsätze mit der Eurozone.
Auch neue Umfrageergebnisse legen leider keine baldige Trendwende zum Besseren nahe. Dr. Uwe Mazura, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Textil- und Modeindustrie: „Unsere Branche hat in den vergangenen 5 Jahren rund 20 Prozent an realem Wachstum eingebüßt, wir erleben Rekordzahlen bei den Firmenpleiten, Traditionsunternehmen sind gezwungen, dem Standort Deutschland den Rücken zu kehren, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind.“ Dennoch tritt der Verband entschieden für einen freien Handel ein, weil die deutsche Textil- und Modeindustrie untrennbar mit Handelspartnern rund um den Globus verwoben sei.
„„Unsere Branche hat in den vergangenen 5 Jahren rund 20 Prozent an realem Wachstum eingebüßt, wir erleben Rekordzahlen bei den Firmenpleiten, Traditionsunternehmen sind gezwungen, dem Standort Deutschland den Rücken zu kehren, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind.“
Uwe Mazura, Hauptgeschäftsführer beim Gesamtverband textil+mode
Deutscher Industrieverband für Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik e. V. (SPECTARIS)
Die wirtschaftliche Situation der Mitgliedsunternehmen von SPECTARIS ist stabil, aber herausfordernd. Nach einem Umsatzplus von fast sieben Prozent im Vorjahr hat die Konjunkturschwäche auch bei Optik, Photonik, Analysen- und Medizintechnik Spuren hinterlassen. Trotz ihrer Robustheit im Vergleich zu vielen anderen Wirtschaftszweigen des produzierenden Gewerbes konnte die Dynamik der vergangenen Jahre nicht aufrechterhalten werden. Konsumzurückhaltung und anhaltende Inflationseffekte stellen die Branche weiterhin vor Herausforderungen. Zudem führt der Fachkräftemangel zu einem zunehmenden Wettbewerb um Talente.

Die deutschen Hersteller von Augenoptik und Consumer Optics haben das Jahr 2024 beispielsweise mit einem nominalen Umsatzwachstum von rund 1 Prozent auf 4,96 Milliarden Euro abgeschlossen. Während das Inlandsgeschäft knapp über der Nullmarke lag, zeigte sich das internationale Geschäft leicht verbessert. Besonders das Geschäft innerhalb der Europäischen Union konnte mit zulegen. Der Auslandsumsatz macht etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Die Zahl der Beschäftigten ging um ein Prozent geringfügig zurück.
Jörg Mayer, Geschäftsführer von SPECTARIS: „Die aktuellen Zahlen verdeutlichen die Herausforderungen, mit denen die SPECTARIS-Branchen konfrontiert sind: Ungebremst zunehmende Regulierung, internationale Handelshemmnisse und ein zu langsamer Fortschritt bei der Digitalisierung erschweren es unseren Mitgliedsunternehmen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Gezielte Maßnahmen sind notwendig, um die Wachstumsdynamik wieder anzukurbeln und die Standortattraktivität Deutschlands zu stärken.“
Dabei sind die Zukunftsaussichten gut, denn SPECTARIS-Branchen zählen zu den chancenreichsten Zukunftsbranchen der deutschen Wirtschaft. Dies zeigt eine aktuelle Studie der FutureManagementGroup, die in Kooperation mit dem Deutschen Industrieverband SPECTARIS entstanden ist. Die Untersuchung analysierte 25 Industriezweige hinsichtlich zentraler Zukunftstrends bis 2040. Die übergreifende Branche Analysen-, Labor- und Medizintechnik belegte dabei Platz vier, Optik und Photonik Platz sechs.
Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e. V. (Gesamtmetall)
Die Produktion in der Metall- und Elektro-Industrie (M+E-Industrie) ist im Jahr 2024 um 6,6 Prozent zurückgegangen. Damit fiel der Rückgang in der mit rund 25.000 Unternehmen und über 3,9 Millionen Beschäftigten größten Industriebranche noch stärker aus als befürchtet. Gesamtmetall-Chefvolkswirt Lars Kroemer: „Mit dem erneuten Einbruch im Dezember schrumpfte die Produktion das siebte Quartal in Folge. Das ist ein Negativrekord. Seit der Wiedervereinigung gab es noch keine so lange Rezession in der deutschen Leitindustrie. Angesichts der anhaltend schwachen Nachfrage und desolaten Standortbedingungen rechnen wir auch für 2025 mit einem erneuten Produktionsrückgang um 2,5 Prozent.“

Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf blickt daher mit Sorge auf die Situation in der Metall- und Elektro-Industrie: „Unsere Branche hat im vergangenen Jahr rund 45.800 Arbeitsplätze verloren. Ich befürchte, dass wir auch 2025 einen weiteren Stellenabbau erleben werden.“ Die Auftragsbestände würden von den Unternehmen derzeit so schlecht beurteilt wie auf den Höhepunkten der Finanzkrise 2009 oder der Corona-Pandemie 2020.
Geteilt wird sein Pessimismus von den Mitgliedsunternehmen. Die Bedingungen für private Investitionen in Deutschland sind aus ihrer Sicht desolat. Laut einer bundesweiten Umfrage von Gesamtmetall unter den Mitgliedsunternehmen der M+E-Arbeitgeberverbände haben sich für 93 Prozent aller Unternehmen die Standortbedingungen in den vergangenen 10 Jahren verschlechtert. Die Folgen: Jedes zweite Unternehmen will seine Investitionen in Deutschland weiter reduzieren, gut 30 Prozent dafür mehr im Ausland investieren.
Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH)
Wie attraktiv die e-handwerklichen Berufe sind, zeigt sich an den Auszubildendenzahlen. Diese liegen seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau und wiesen 2024 – zum zehnten Mal in Folge – einen Anstieg aus. Das Plus von 0,6 Prozent zeigt jedoch, dass zusätzliches Wachstum vor dem Hintergrund des demografischen Wandels nur noch schwer erreichbar ist. 2024 machten insgesamt 46.481 junge Menschen eine Ausbildung in den E-Handwerken.

Wirtschaftlich läuft es nicht ganz so rund: Nach Jahren stetigen Wachstums vermelden die Elektrohandwerke für 2024 erstmals einen Rückgang bei Umsatz, Unternehmens- und Beschäftigtenzahl. Das zeigt: Trotz Energiewende kann sich auch das größte Klimahandwerk nicht mehr vom Trend abkoppeln. So fiel der Jahresumsatz 2024 um 4 Prozent auf 84,3 Milliarden Euro. In den Jahren zuvor war der Umsatz kontinuierlich in die Höhe geklettert. Das entspricht dem Bild aus den Betrieben, die zuletzt vermehrt Umsatzrückgänge und sinkende Auftragsvolumina gemeldet hatten. Innerhalb der drei e-handwerklichen Bereiche – Elektrotechniker-Handwerk, Informationstechniker-Handwerk und Elektromaschinenbauer – verzeichnete das Elektrotechniker-Handwerk mit 4,8 Prozent das größte Minus. Der Umsatz im Bereich „Elektromaschinenbau“ schrumpfte um 2,9 Prozent, das Informationstechniker-Handwerk hingegen konnte seinen Umsatz um 5,7 Prozent steigern.
Ebenfalls rückläufig war die Beschäftigtenzahl in den E-Handwerken. Sie verringerte sich um 1,4 Prozent auf 516.709. Als relativ stabil erwies sich mit 48.178 indes die Zahl der e-handwerklichen Unternehmen. Sie sank 2024 lediglich um 47.
„Angesichts wachsender geopolitscher Spannungen wird der europäische Binnenmarkt immer wichtiger.“
Dr. Gunther Kegel, Präsident ZVEI
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V. (ZVEI)
„Das vergangene Jahr war für die deutsche Elektro- und Digitalindustrie sehr schwierig. Die Branche verbüßte Rückgänge bei allen relevanten Kennzahlen“, fasst ZVEI-Präsident Dr. Gunther Kegel das Jahr 2024 kurz zusammen. Der Branchenumsatz lag bei 223,2 Milliarden Euro und damit 6,2 Prozent niedriger als im Rekordjahr 2023. Etwas mehr als die Hälfte der Erlöse wurden im Auslandsgeschäft erzielt. Die Auftragseingänge gingen um 9,6 Prozent zurück. Hier fiel das Minus bei den Inlandsbestellungen mit 12,9 Prozent höher aus als der Rückgang bei den Orders ausländischer Kunden (−6,6 Prozent). Aus dem Euroraum gingen zwischen Januar und Dezember 8,5 Prozent weniger neue Aufträge ein, aus Ländern außerhalb des gemeinsamen Währungsraums 5,6 Prozent.
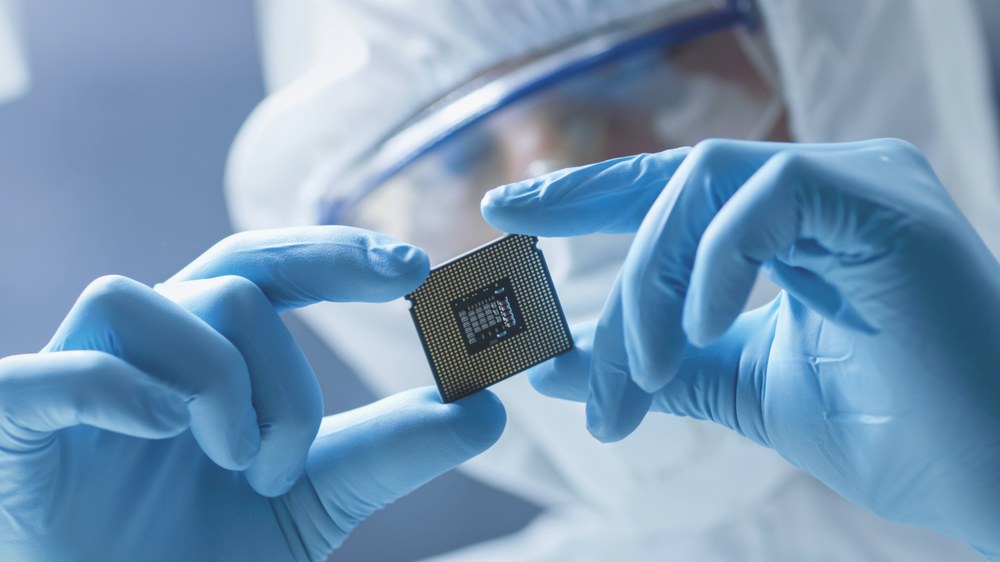
Die Produktion elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse in Deutschland zeigt ein Minus beim Output von 9,1 Prozent. Auch das neue Jahr bringt noch keine Trendwende: „Für 2025 geht der ZVEI derzeit von einem realen Produktionsrückgang um zwei Prozent aus“, so ZVEI-Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann.
Vor allem die Nachfrage in Deutschland bleibt schwach: Während die Inlandsbestellungen auch zum Jahresanfang deutlich rückläufig waren, zogen die Auslandsbestellungen an – sowohl von Kunden aus der Eurozone als auch aus Drittländern. Die branchenweite Kapazitätsauslastung lag zu Jahresanfang bei rund 75 Prozent: „Während aktuell nur noch 14 beziehungsweise 10 Prozent der Elektrounternehmen über Fachkräftemangel und Materialknappheit klagen, sind 54 Prozent von Auftragsmangel betroffen“, sagt Andreas Gontermann. Allerdings legten die Auftragseingänge im März wieder zu.
Bundesverband Druck und Medien (bvdm)
Im Frühjahr waren die vom ifo Institut befragten Entscheider der Druck- und Medienunternehmen vorsichtig optimistisch, was die Entwicklungen der nächsten sechs Monate angeht. Im März 2025 verzeichnete der saisonbereinigte Geschäftslageindex im Vergleich zum Februar zwar einen Rückgang, lag aber rund 4,8 Prozent über dem entsprechenden Monat des Vorjahrs sowie rund 1,4 Prozent über dem Vorjahresmittel.

Die Geschäftsaussichten der Unternehmen für die nächsten sechs Monate entwickelten sich im März positiv. Der saisonbereinigte Index der Geschäftserwartungen stieg um 4 Prozent. Mit einem Indexwert von 93,3 notierten die Geschäftserwartungen damit rund 6,9 Prozent über dem Niveau des entsprechenden Vorjahresmonats. Rund 71 Prozent der Unternehmen erwarteten eine stabile Geschäftsentwicklung für die nächsten 6 Monate, während 22 Prozent von einer Verschlechterung und 7 Prozent von einer Verbesserung ausgingen.
Der Fachkräftemangel bleibt ein Problem für die Druck- und Medienunternehmen. Die Besetzung der angebotenen Ausbildungsstellen ist zwar leicht gestiegen, dennoch bleibt es schwierig, geeignete Auszubildende und Fachkräfte zu finden. Dies belegen die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage zur Ausbildungs- und Fachkräftesituation des BVDM. Die Unternehmen setzen verstärkt Maßnahmen zur Nachwuchskräftegewinnung ein, jedoch ohne durchschlagenden Erfolg. Zentrale Gründe sind einerseits die steigende Anzahl von Schulabgängern mit Abitur, die studieren, andererseits der hohe Anteil (58 Prozent) ungeeigneter Bewerber. Die Ausbildungsbereitschaft der befragten Druck- und Medienunternehmen sinkt mit einem Anteil von 66 Prozent leicht.
„Jeder Euro, der in die Infrastruktur investiert wird, ist eine Investition in die Zukunft: in Versorgungssicherheit, in Wettbewerbsfähigkeit und in Klimaneutralität.“
Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung

Diesen Beitrag teilen